|
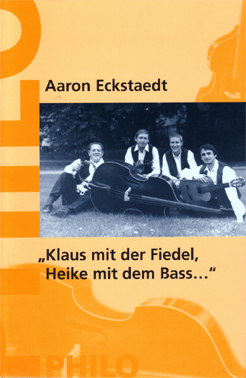 |
"Klaus
mit der Fiedel, Heike mit dem Bass..."
Jiddische
Musik in Deutschland.
A
Philo-Verlag,
Berlin 2003
342 S., kt., 15,- €, ISBN
978-3-86572-302-4
>
Abstract pdf
> Rezensionen pdf |
Aaron
Eckstaedt, promovierter Musikwissenschaflter und Klesmermusiker,
untersucht das Phänomen Jiddische Musik in Deutschland und deren
erstaunliche Popularität in den letzten Jahren sowohl bei jüdischen
als auch bei nichtjüdischen deutschen Musikern. Er zeigt, wie
sich in den Lebensgeschichten der Musiker persönliche Bedeutungen
ihrer musikalischen Tätigkeit herausbilden, auf welche Weise
diese zur Identitätsbildung beitragen und welche Bedeutung es für
sie hat, gerade in Deutschland jiddischer Musik zu machen.
Aaron
Eckstaedts Monographie vermittelt ein anschauliches Bild von den
Erfahrungen und dem Selbstverständnis der Musizierenden. Sie
folgt den verschiedenen Wegen und Beziehungen der Musiker zu ihrer
Musik: als Befreiung, Stiftung von Identität sowie als öffentliche
und persönlich Erinnerungsarbeit. Jiddische Musik in Deutschland
ist weitaus mehr als nur Vergangenheitsbewältigung.
A
A
"...mit
Klavier hab´ ich dann auch aufgehört"
Instrumentalspiel,
Musikalität und Leistungsanspruch
Augemus-Musikverlag,
Bochum 1996
173
S., kt., 25,- €, ISBN 3-924272-98-0
A
Viele Menschen haben ein Instrument erlernt oder hegen den Wunsch,
dies zu tun. Sie spielen aber dennoch nicht, haben oftmals den
Unterricht abgebrochen oder halten sich für
"unmusikalisch". Der Autor versucht aus wechselnden
Blickwinkeln diesen Fragenkomplex wissenschaftlich aufzuarbeiten
und geht dabei hauptsächlich vier Fragen nach:
-
Was
eigentlich heißt "Musikalität" und auf welchen
Voraussetzungen beruhen gängige Definitionen?
-
Wie
entstanden Inhalte und Methoden unserer Ausbildung am
Instrument?
-
Was
haben ehemalige Schülerinnen und Schüler erlebt, die mit
Attributen von "unmusikalisch" bis
"hochbegabt" belegt wurden? Warum wurde
Instrumentalunterricht abgebrochen?
-
Wo
wurde und wird Kritik an herkömmlicher Instrumentalausbildung
geübt?
Rezension
in: Üben & Musizieren, Heft 3/1997, S.
57. Von Albrecht Goebel.
Eckstaedts
Buch wird vor allem bei solchen LeserInnen Interesse finden, die
auf eine steinige oder gar mißlungene "Karriere" als
InstrumentalschülerInnen zurückblicken und nach den Gründen
fragen. Zugleich wird die Studie jene InstrumentallehrerInnen
ansprechen, die solches Mißlingen verhindern wollen. Schließlich
gibt das Buch einen informativen Überblick speziell über die
Klavierdidaktik seit dem 18. Jahrhundert, verbunden mit einer
kenntnisreichen Einführung in die Sozialgeschichte des
Privatmusiklehrers, jenes Lehrertyps also, dem seit dem vorigen
Jahrhundert die Instrumentalausbildung im wesentlichen obliegt.
Für
Eckstaedt und zahlreiche andere Autorinnen, die im ersten Teil des
Buchs durch Zitate zu Wort kommen, liegt das Scheitern im privaten
Instrumentalunterricht oder im Unterricht an Musikschulen und
Konservatorien nicht etwa in der musikalischen Schwäche der Schüler
und Schülerinnen begründet. Vielmehr ist die Ursache darin zu
sehen, daß sich die Instrumentaldidaktik auch heute noch zu einem
großen Teil am Bild des glänzenden Virtuosen orientiert. Der
Pianist, die Geigerin oder der Cellist, der mit großer Literatur
brilliert und unerreichbar über dem Publikum schwebt, regiert
gleichsam in den Instrumentalunterricht hinein. So kann sich ein
Klavierlehrer mit dem, wie Hindemith anmerkt, "Ressentiment
des verhinderten Konzertpianisten" (S. 64) bei seiner Tätigkeit
nicht von seiner Liebe zur großen Konzertliteratur des 18. und
19. Jahrhunderts und seiner Sehnsucht nach dem effektvollen
Auftritt im Konzertsaal lösen und traktiert entsprechend seine
(armen) SchülerInnen. Eine Violinlehrerin richtet ihre
Vorstellungen an Spitzenwerken ihres Fachs aus und bezieht von
dort - vielfach unbewußt - entscheidende didaktische Impulse.
Nicht anders verhalten sich die VertreterInnen der übrigen
Instrumente. Die Folge ist, daß etwa der Klavierlehrer seinen Schülern
jene jahrelange "Einzelhaft am Klavier" (Wehmeyer)
verordnet, die er schon selbst durchlitten hat und die dann
manchen Schüler den Instrumentalunterricht mit dem Trauma persönlichen
Scheiterns abbrechen läßt. Eckstaedt belegt diese Entwicklung
mit verschiedenen Beispielen aus der Geschichte des
Instrumentalunterrichts. Den zweiten Teil des Buchs nutzt der
Autor, um Wege aus dem angedeuteten Dilemma aufzuzeigen. Unter Berücksichtigung
der einschlägigen Literatur (Gellrich, Grimmer, Mahlert, Szende,
Wehmeyer u. a.) plädiert er für einen Instrumentalunterricht,
bei dem die individuelle Musikalität im Sinne eines ganz persönlichen
musikalischen Interesses Berücksichtigung findet. Die Vorteile
liegen für den Autor auf der Hand: Einerseits verliert die
"Virtuosen-Didaktik" ihre problematische Dominanz;
andererseits gewinnt der Instrumentalunterricht an methodischer
Vielfalt und Breite der musikalischen Inhalte. Mit der
entschiedenen Hinwendung zum Schüler und seinen musikalischen
Neigungen wird - so Eckstaedt außerdem ein entscheidender Schritt
auf eine erhöhte Akzeptanz und Dauerhaftigkeit des
Instrumentalunterrichts getan, da nicht mehr Ziele wie das überkommene
Ideal des Virtuosen oder ähnliches den Instrumentalunterricht
bestimmen und entfremden: "Instrumentalpädagogik hat die
"Musiktotate der Gegenwart" einzubeziehen und dem Schüler
die Möglichkeit zu geben, ein Verhältnis zu "seiner"
Musik zu entwickeln - persönliche Lernerfolge können sich nur
dort ereignen, wo der primäre Motivationsgegenstand Musik mit
persönlicher Bedeutung verknüpft ist. Überkommene Grenzen
zwischen E- und U-Musik sind aufzuheben, andere Musikstile können
nicht mit den Methoden traditioneller Instrumentalerziehung
vermittelt werden, sondern erfordern ein "hörendes"
Vorgehen. Das Problem der Vermittlung liegt in einer Offenheit,
die den Zugang zu Neuem nicht verbaut und an die Stelle von
Zuweisungen des "Werts" von Musik eine begründete und
individuell geschmackliche Orientierung setzt." (S. 156)
Das
wegen seiner klaren Disposition gut lesbare Buch schließt mit
einem umfangreichen, dem aktuellen Stand angepaßten
Literaturverzeichnis, das nicht zuletzt jenen
InstrumentaIlehrerInnen eine Hilfe sein wird, die sich mit
instrumentaldidaktischen Fragen auch theoretisch auseinandersetzen
möchten.
Die Bücher sind im Handel
erhältlich oder können via E-Mail, Fax oder Brief direkt bestellt werden. kontakt
©
aaron eckstaedt 2012
|
|